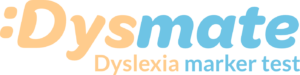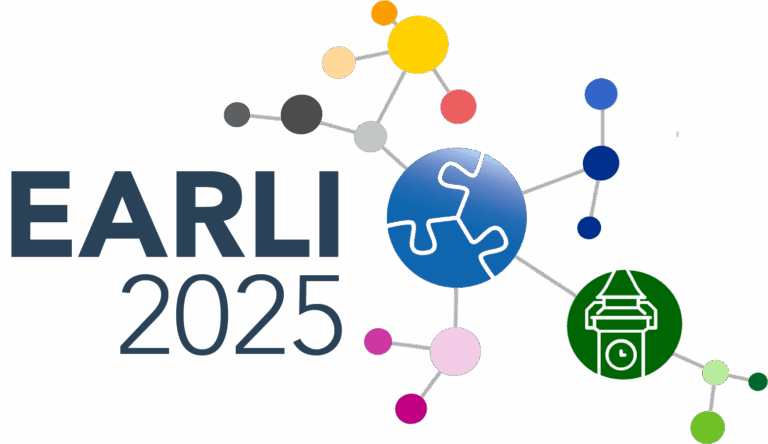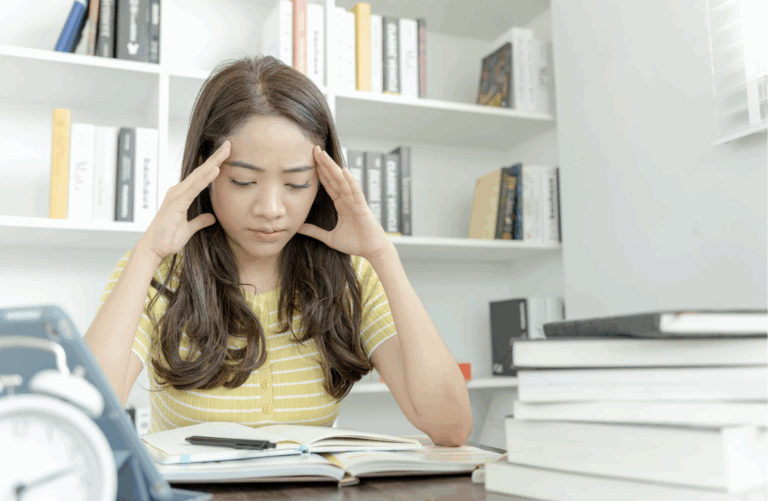Friedo Scharf: Frau Prof. Vierbuchen, lassen Sie uns direkt einsteigen: Wenn wir über “Lernschwierigkeiten” sprechen – was meinen wir da eigentlich genau? Und worin unterscheiden sie sich von sogenannten “Lernstörungen”?
Marie-Christine Vierbuchen: Lernschwierigkeiten ist ein Begriff, der wesentlich weiter greift als Lernstörungen. Lernstörungen werden ja in verschiedenen Kategoriensystemen wie z.B. der ICD in Bezug auf das doppelte Diskrepanzkriterium definiert, werden also nur diagnostiziert, wenn nicht nur eine deutlich schlechtere Schulleistung als die Bezugsgruppe der gleichen Jahrgangsstufe/des gleichen Alters, sondern ebenso ein deutlicher Abstand zwischen Schulleistung und Intelligenzleistung vorliegt.
Im breiteren Begriffsverständnis, also Lernschwierigkeiten, sind also auch diejenigen einbezogen, die im Lesen, Schreiben und/oder Rechnen, aber vielleicht auch in den kognitiven Kompetenzen Schwierigkeiten aufweisen. Damit haben wir eine breitere Zielgruppe, die gezielte Unterstützung für gelingende Entwicklung erhalten kann und sollte. Zudem wird es dadurch möglich, früher Schwierigkeiten zu erkennen und nicht bis zum völligen Scheitern warten zu müssen, um gezielt und begründet unterstützen zu können.
💡 Das doppelte Diskrepanzkriterium führt dazu, dass viele Kinder keine offizielle Diagnose erhalten, obwohl ein eindeutiger Förderbedarf besteht. Ein weiter gefasster Lernschwierigkeiten-Begriff ermöglicht frühzeitigere und breitere Unterstützung.
Friedo Scharf: Und welche Bedeutung hat Diagnostik in Ihrem Verständnis von inklusiver Schule? Ist das nicht manchmal ein Widerspruch?
Marie-Christine Vierbuchen: In meinem Verständnis spielt Diagnostik eine große Rolle für Chancengerechtigkeit in der inklusiven Bildung. Um spezifisch zu fördern muss ich individuelle Unterstützung sowohl in der Klasse also auch in Einzel- oder Kleingruppenförderung umsetzen können. Dazu muss ich wissen, welche Stärken und Schwächen vorhanden sind und wie die Lernumgebung unterstützend für die Schülerinnen und Schüler gestaltet werden kann. Das weiß ich nicht intuitiv, das muss ich differenziert und am besten auch noch im Verlauf mit hilfreichen und möglichst gut einsetzbaren diagnostischen Tools erfassen und in Förderung überführen können.
💡 Prof. Vierbuchen betont hier die Bedeutung einer “förderdiagnostischen Haltung” – Diagnostik wird nicht als Selektion, sondern als Grundlage gezielter Förderung verstanden.
Friedo Scharf: Wenn Sie auf den Schulalltag blicken: Wie gut klappt das mit der Unterstützung bei Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten aktuell?
Marie-Christine Vierbuchen: Hier will ich ungern verallgemeinern, weil es sehr unterschiedlich ist. Ich höre oft aus der Praxis, dass Lehrkräfte sich sehr gut kümmern, viel Wissen und hohe Kompetenzen im Bereich der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten haben, im Unterrichtsalltag Unterstützung installieren und eng an den Stärken und Schwächen der Kinder und Jugendlichen arbeiten und ermutigen. Ich höre allerdings auch aus der Praxis, wie hilflos sich oft die Beteiligten fühlen und wenig Knowhow zur konkreten Unterstützung haben. Es hängt zu sehr von Einzelpersonen ab, wir benötigen klare Ansprechpartner*innen und wirksame Unterstützung in der Identifizierung, Interpretation und Förderung. Also, meine Bewertung: Die aktuelle Praxis ist zu inkonsistent und zu unterschiedlich. Wir benötigen mehr zuverlässige Strategien und systematische Umsetzung.
Friedo Scharf: Inwiefern sind Ihnen hier konkrete Hürden in der Diagnostik begegnet, etwa durch zu enge Definitionen oder bürokratische Anforderungen?
Marie-Christine Vierbuchen: Hier kann ich nur aus dem Bereich der Forschung über und mit der Diagnostik berichten. Und da habe ich einige Hürden erfahren. Ganz vorne dabei sind Aufklärungsschreiben, die sehr komplex und viel zu unverständlich sind, aber den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. So werden aus meiner Perspektive systematisch Kinder, Jugendliche und Eltern von Forschung ausgeschlossen. Dadurch sind manche Zielgruppen z.B. nicht so gut in Normierungsstichproben vertreten, wie wir uns das wünschen würden. Ein weiterer Punkt ist, dass z.B. einige Ministerien der Bundesländer uns sehr unterstützt haben in der Umsetzung von Untersuchungen, andere, gottseidank nur ganz wenige, mit Argumenten wie „Bei uns gibt es kein LRS in der Sekundarstufe“ oder „Es ist den Lehrkräften nicht zuzumuten, noch was digitales zu machen“ abgelehnt haben, dass wir Schulen in ihren Bundesländern für die Mitwirkung an Studien anfragen.

Friedo Scharf: Ein Baustein dafür könnten digitale Tools sein. Was halten Sie von Verfahren wie Dysmate?
Marie-Christine Vierbuchen: Ich sehe darin eine große Chance, die Barrieren der Nutzung von Diagnostik im schulischen Alltag zu senken. Lehrkräfte können dadurch gut entlastet und Schüler*innen zuverlässiger und gerechter diagnostisch begleitet werden. Die Durchführung ist meist einfach in einer großen Gruppe umsetzbar (wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind). Die Instruktionen, Beispielaufgaben und Rückmeldungen werden jedem gleich vorgelegt. Und die Bewertung der Antworten im Prozess sowie die Rückmeldung der Ergebnisse an die durchführenden Personen geschieht sofort und nach immer gleichen Maßstäben.
💡 Dysmate wurde von Prof. Vierbuchen und ihrem Team für den deutschsprachigen Raum adaptiert und normiert. Die automatisierte Auswertung und Standardisierung entlastet Schulen und sorgt für Vergleichbarkeit.
Friedo Scharf: Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, damit schulische Interventionsforschung wirklich wirksam wird?
Marie-Christine Vierbuchen: Lieber Herr Scharf, das sind ganz schön komplexe Fragen. Hier könnte man eine eigene Vorlesung samt Seminar zu gestalten. Ich versuche einfach mal, ganz kurz ein paar Schlagworte zu benennen: Erstens ist es wichtig, dass ich die Intervention vorher bereits theoretisch überprüfe und einige Fragen stelle: Erfüllt sie das, was wir theoretisch und empirisch bereits wissen? Welche Vorannahmen setze ich? Das verhindert, dass wir mit Interventionsforschung die Praxis überschwemmen, die nur das bestätigt, was bereits vorher in unterschiedlichen Kontexten als nicht hilfreich identifiziert wurde. Zweitens muss ich mir im Klaren darüber sein, was ich herausfinden möchte und welche Dimensionen oder Konstrukte (z.B. Leseflüssigkeit oder Lesesinnverständnis) ich erfassen möchte, um wirklich überprüfen zu können, ob die Intervention erfolgreich ist. Und dann ist die Frage, ob es dazu bereits gute Instrumente gibt, diese Dimensionen sinnvoll und möglichst ökonomisch zu erfassen (Leistungstests, Fragebögen, Interviews, Beobachtungen). Drittens muss ich die Intervention in der schulischen Praxis so umsetzen, dass sie den Alltag gut widerspiegelt: Also (je nach Zielgruppe) eine möglichst breite/repräsentative Stichprobe und den Alltag in Fächern, Zeiten, Rahmenbedingungen möglichst vergleichbar aufnehmen. Hier kommt es aber sehr auf das Studiendesign an, z.B.: Setze ich Einzelfallanalysen ein, wo jeder Probandin selbst eine eigene Baseline vor der Intervention darstellt oder nehme ich eine große Gruppe als Experimentalgruppe und eine vergleichbare Gruppe als Kontrollgruppe?
Weitere zentrale Elemente dann in der Praxis selbst betreffen die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis. Wie binde ich die Beteiligten, wie Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern, pädagogische Fachkräfte, Schulsozialarbeit usw. ein? Und wie kommuniziere ich die Ergebnisse der Untersuchung? Sind die Ergebnisse erreichbar und relevant für Personen aus Praxis und Wissenschaft?
Friedo Scharf: Was hilft aus Ihrer Sicht besonders, um Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten frühzeitig zu unterstützen?
Marie-Christine Vierbuchen: Das kommt auf die konkreten Schwierigkeiten und auch das Alter an. Übergeordnet ist es wichtig zu wissen, welche Stärken und Schwächen vorliegen – also diagnostisch genauer hinzugucken. Dann ist eine gute Beziehung zwischen der Lehrkraft und den Kindern grundlegend, um sich sicher zu fühlen sowie Fehler zuzulassen und als bedeutsame Lerngelegenheiten mit wirksamem Feedback zu nutzen. Eine positive Lernatmosphäre muss die Basis sein. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern, um zu Hause Druck und Missverständnisse vermeiden zu können, kann wirksam sein. Sprachtherapie, Logotherapie und weitere Fachkräfte können ggf. ebenso hinzugezogen werden.
In der frühen Kindheit und schulischen Eingangsstufe ist z.B. eine Förderung der phonologischen Bewusstheit ggf. sinnvoll. Später, je nach Entwicklungsstand, geht es vielleicht eher um Leseflüssigkeit oder Textverständnis, hier können kooperative Methoden wie Lautlesetandems oder Reziprokes Lesen wertvolle Förderung bieten. Das sind nur Beispiele. Es gibt mittlerweile auch tolle digitale Möglichkeiten der systematischen Förderung des Lesens und Schreibens.
Natürlich spielen hier Aspekte wie Nachteilsausgleich oder Notenschutz auch eine Rolle, aber nicht im Sinne der Förderung, sondern eher im Bereich der Chancengerechtigkeit. Es sind keine wirksamen Maßnahmen zur Unterstützung zur Überwindung der Schwierigkeiten und dürfen nie die alleinigen Mittel sein!
Friedo Scharf: Welche Haltung braucht es Ihrer Meinung nach, damit Lehrkräfte Diagnostik und Förderung wirksam miteinander verbinden?
Marie-Christine Vierbuchen: Meiner Meinung nach benötigt es eine professionelle (sonder-) pädagogische Einstellung, die sich zuständig fühlt für die Analyse und aktive Gestaltung der individuellen Lernsituationen und Rahmenbedingungen, unter denen Kinder und Jugendliche lernen und sich entwickeln. Eigentlich würde ich es vielleicht als „inklusive Haltung“ benennen. Lehrkräfte (und andere professionelle Fachkräfte) mit einer solchen Haltung sind in meiner Vorstellung überzeugt, dass allen Kindern und Jugendlichen Unterstützung zusteht und Förderung möglich ist, wenn die richtige Form der Unterstützung gefunden wird. Dazu würde für mich auch gehören, dass gute Zusammenarbeit in Schule und darüber hinaus angestrebt und Arbeit im multiprofessionellen Team umgesetzt wird. Es muss nicht jeder alles können, aber man sollte Wissen und Kompetenzen teilen und gegenseitig ansprechbar sein. Eine solche Haltung heißt aber auch, das eigene Handeln zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln.
Friedo Scharf: Wie lassen sich Diagnostik und Förderung in einem inklusiven Klassenzimmer sinnvoll verbinden – trotz Zeitdruck und Fachkräftemangel?
Marie-Christine Vierbuchen: Durch ein Zusammenspiel von Faktoren wie Digitalisierung, die Implementation von abgestimmten und transparenten Konzepten für die verschiedenen Fächer und Kompetenzen und eine enge Zusammenarbeit der Beteiligten, lässt sich sicher vieles wesentlich besser umsetzen. Trotzdem muss man sagen, dass Zeitdruck und Fachkräftemangel keine guten Ratgeber für die Schulentwicklung sind. Es kann jedoch gelingen, Entlastung zu schaffen, wenn man auf gute praxisnahe und wissenschaftlich basierte Möglichkeiten zurückgreift und sie geschickt kombiniert. Wertvoll ist es auch, Systematiken einzuführen und einzuhalten und klare Zuständigkeiten abzustimmen (wann im Schuljahr, wer, welche Aspekte umsetzt und wie die Ergebnisse zurückgespielt und genutzt werden können für die Förderplanung und die Unterrichtsgestaltung).
Friedo Scharf: Und was bedeutet das für die Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern, Fachkräften?
Marie-Christine Vierbuchen: Ich glaube aus den obigen Antworten lässt sich bereits ablesen, für wie wertvoll, ja sogar unumgänglich, ich Kooperation und multiprofessionelle Zusammenarbeit halte. Und zwar sowohl innerhalb der Schule als auch darüber hinaus. Auch aus dieser Zusammenarbeit, wenn sie denn am besten frühzeitig implementiert wurde, ohne, dass eine Krise herrscht, können Ressourcen und Entlastungen (in Anlehnung an die vorherige Frage) geschöpft werden. Und das sehen wir auch in unserer Studie Dysmate im engen Kontakt mit der Praxis: Eltern, Logopädie, Sonderpädagogik, Lerntherapie, Lehrkräfte – es beschäftigen sich so viele Personen mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, das kann sehr gut Hand in Hand gehen.
Friedo Scharf: Frau Prof. Vierbuchen, zum Abschluss noch eine etwas persönlichere Frage: Was hat Sie eigentlich ursprünglich dazu bewegt, sich mit diesem Themenfeld wissenschaftlich zu beschäftigen?
Marie-Christine Vierbuchen: Ich denke, dass jedes Kind – unabhängig aber unter Beachtung von individuellen Voraussetzungen – das Potenzial hat, erfolgreich zu lernen und sich weiterzuentwickeln. In der Forschung möchte ich noch mehr darüber erfahren, wo Stolpersteine liegen und welche Bedingungen Lernprozesse bei Kindern mit Lernschwierigkeiten besonders unterstützen, und in der Lehrkräftebildung sehe ich die Chance, diese Erkenntnisse mit der Praxis gemeinsam abzugleichen und so Handlungsmöglichkeiten zu generieren. Es berührt mich, wenn ich mitbekomme, wie durch gezielte Unterstützung Selbstvertrauen und Erfolgserlebnisse bei Kindern, die oft mit komplexen Herausforderungen kämpfen, wachsen können. Diese Kombination aus Theorie und Praxis, aus Erkenntnisgewinn und direkter Wirksamkeit, begeistert mich immer wieder aufs Neue.
Friedo Scharf: Sie haben in der psychosozialen Notfallversorgung gearbeitet. Prägen Erfahrungen aus dieser Zeit Ihre pädagogische Haltung heute?
Marie-Christine Vierbuchen: Das ist eine gute Frage, da haben Sie sehr gut recherchiert. Die Frage finde ich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich denke, die grundlegende Haltung, die eine Brücke zwischen einerseits professionellem Abstand und andererseits Zugewandtheit, Respekt und die Wahrnehmung der Überforderung und Hilflosigkeit in genau dieser Situation baut, die ist bedeutsam. Die ehrenamtliche Erfahrung in der psychosozialen Notfallversorgung hat mich vor allem für die Bedeutung von Empathie, Ruhe und Beziehungssicherheit in Ausnahmesituationen sensibilisiert. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, Menschen in Krisen zunächst zuzuhören, ihre Gefühle ernst zu nehmen und ihnen Halt zu geben, ohne vorschnell zu bewerten oder zu handeln. Diese Haltung übertrage ich auch auf die pädagogische Haltung im Kontext von Lernschwierigkeiten: Jedes Kind bringt seine eigene Geschichte, seine Herausforderungen und Stärken mit. Es ist wichtig, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der sich Kinder gesehen und angenommen fühlen – denn erst dann kann nachhaltiges Lernen gelingen und wirksame Methoden eingesetzt werden. Die Fähigkeit, mit Unsicherheiten umzugehen, ruhig zu bleiben und die Perspektive des Gegenübers einzunehmen, ist dabei ein zentraler Anker meiner pädagogischen Haltung.
Friedo Scharf: Wo sehen Sie derzeit das größte Missverständnis im gesellschaftlichen Umgang mit Schüler:innen, die besondere Unterstützung brauchen?
Marie-Christine Vierbuchen: Ein Missverständnis könnte Mitleid aus der gesellschaftlichen Umgebung sein und damit eine Aberkennung der Möglichkeiten der Entwicklung und der Anstrengung, die manche Kinder und Jugendliche einsetzen, um Ziele zu erreichen und ihr Leben zu gestalten. Ein zentrales Missverständnis in unserer Gesellschaft ist die Vorstellung, dass Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf primär ein Problem darstellen – für den Unterricht, für die Lehrkräfte oder für die Leistungsstatistik. Dabei wird oft übersehen, dass nicht das Kind das Problem ist, sondern dass unser Bildungssystem häufig noch nicht flexibel und gut genug ausgerichtet ist, um Vielfalt gerecht werden zu können. Wir sollten den Blick stärker auf Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten richten, ohne die Defizite und die spezifische Förderung zu vernachlässigen. Inklusion bedeutet nicht nur räumliche Integration, sondern die konsequente Haltung, dass jedes Kind ein Recht auf passende Lernangebote und Anerkennung hat – unabhängig von seinen Voraussetzungen. Dieses Umdenken erfordert gesellschaftlich mehr Offenheit, Ressourcen und ein Bewusstsein dafür, dass individuelle Förderung kein Luxus, sondern Ausdruck von Bildungsgerechtigkeit ist.
Friedo Scharf: Wenn Sie den Bildungsminister:innen in Deutschland eine zentrale Empfehlung geben könnten – welche wäre das?
Marie-Christine Vierbuchen: Ich würde empfehlen, den Fokus konsequent auf Chancengerechtigkeit zu legen – und das nicht nur als bildungspolitisches Schlagwort, sondern als verbindlichen Handlungsrahmen. Das bedeutet beispielsweise: gezielte Investitionen in frühkindliche Bildung, multiprofessionelle Teams an Schulen und eine nachhaltige Förderung von Lehrkräften und allen Beteiligten in ihrer Professionalisierung. Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf brauchen ein System, das Vielfalt von Anfang an mitdenkt, aktiv gestaltet und kompetent präventiv ausgerichtet ist. Dazu gehört auch, gemeinsames sowie individuelles Lernen, das Wohlbefinden aller und die Beziehungsgestaltung in den Blick zu nehmen. Bildung darf kein Selektionstool sein – sondern muss ein Ermöglichungsraum für alle werden.
Friedo Scharf: Herzlichen Dank für das interessante Gespräch!