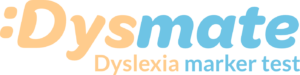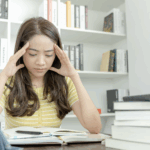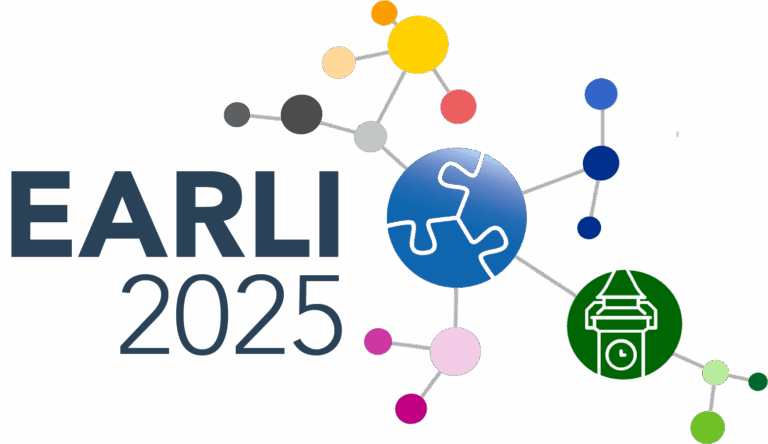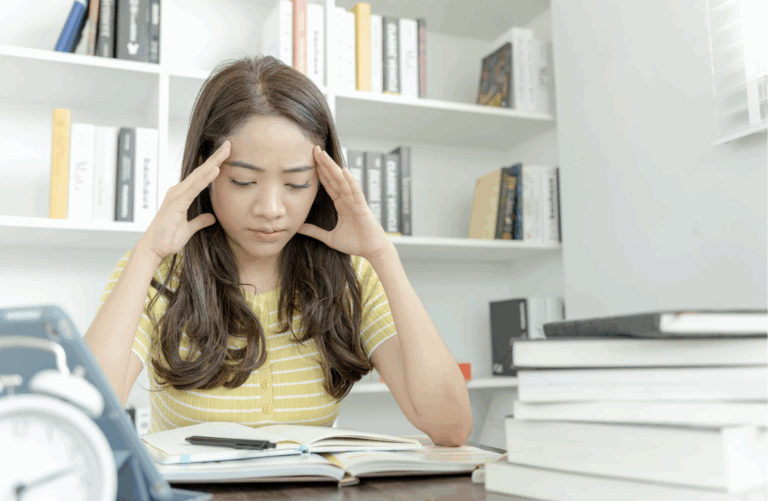Trotz intensiver Forschung und wachsender öffentlicher Aufmerksamkeit ist die schulische Realität für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten oft noch von Unsicherheit geprägt. Die Kriterien für eine formale Diagnose unterscheiden sich zwischen Bundesländern, und viele Schulen stehen vor der Herausforderung, betroffene Schülerinnen und Schüler zuverlässig zu identifizieren und gezielt zu unterstützen. Dabei wäre gerade eine frühe und präzise Diagnostik entscheidend, um langfristige schulische Nachteile und emotionale Belastungen zu vermeiden.
Ein Instrument, das hier neue Wege geht, ist das digitale Testverfahren Dysmate. Es wurde entwickelt, um Lese- und Rechtschreib-Schwierigkeiten evidenzbasiert zu erfassen – effizient, standardisiert und anschlussfähig an moderne und evidenzbasierte Förderkonzepte. Eine zentrale Rolle bei der wissenschaftlichen Begleitung und Normierung von Dysmate für den deutschsprachigen Raum spielt Dr. Rebecca Schumacher, Sprachtherapeutin und akademische Mitarbeiterin im Bereich Inklusionspädagogik mit dem Schwerpunkt Sprache an der Universität Potsdam. Sie forscht seit vielen Jahren zur Diagnostik und Förderung sprachlicher Kompetenzen, insbesondere im schulischen Kontext.
Im Interview spricht Dr. Schumacher über ihre Motivation, sich mit dem Thema Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten zu befassen, ordnet die aktuelle Diagnostikpraxis in Deutschland ein – und erklärt, welche Stärken sie im digitalen Verfahren Dysmate sieht. Dabei zeigt sich: Gute Diagnostik ist nicht nur eine Frage der Testverfahren, sondern auch der Haltung gegenüber Vielfalt im Bildungssystem.

Interview mit Dr. Rebecca Schumacher
Friedo Scharf: Frau Dr. Schumacher, was hat Sie persönlich motiviert, sich mit dem Thema Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten wissenschaftlich und praktisch zu beschäftigen?
Rebecca Schumacher: Mit dem Thema der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (im sprachtherapeutischen/klinischen Kontext auch als „Entwicklungsdyslexie“ bezeichnet) bin ich insbesondere im Rahmen meiner langjährigen praktischen Arbeit als akademische Sprachtherapeutin in einer Logopädischen Praxis in Berlin (2014 – 2020) intensiv in Kontakt gekommen und habe mich dann immer weiter für das Thema interessiert. In meinem Dissertationsprojekt habe ich mich ab 2015 mit sog. erworbenen Dyslexien (Lesebeeinträchtigungen nach einer Hirnschädigung, bspw. Schlaganfall) und der Diagnostik in diesem Feld auseinandergesetzt. Lese- und Schreibfähigkeiten sind sehr bedeutsam für den Bildungserfolg und die alltägliche Partizipation. Praxisnahe Forschung in diesem Bereich ist demnach wichtig, um Betroffenen eine bestmögliche (Bildungs)partizipation zu ermöglichen.
💡Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) betreffen laut Studien etwa 5 bis 10 Prozent der Schülerinnen und Schüler. Eine frühe Erkennung ist entscheidend, um langfristige Bildungsnachteile zu vermeiden.
„Die Entstehungsgeschichte von Diagnosen im Bereich LRS ist sehr unterschiedlich und nicht fair.“
Rebecca Schumacher
Friedo Scharf: Gab es bestimmte Forschungsergebnisse, die Ihre Sichtweise besonders geprägt oder sogar überrascht haben?
Rebecca Schumacher: Im Bereich der erworbenen Dyslexien haben mich während meiner Promotionszeit insbesondere Arbeiten von Naama Friedmann und Saskia Kohnen geprägt und motiviert. Im Zusammenhang mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten/Entwicklungsdyslexie sind die Arbeiten von Margaret J. Snowling, Charles Hulme wegweisend – nicht zuletzt für das internationale Verständnis von Ursachen und Kriterien der Dyslexie und den Diagnosekriterien. Diese Arbeiten sind auch Grundlage unseres Forschungsprojektes „Dysmate“.
Friedo Scharf: Wie sehen Sie die Rolle der Sprachtherapie und inklusiven Pädagogik in der heutigen Bildungslandschaft?
Rebecca Schumacher: Ich nehme wahr, dass wertvolles „Potential“ im Sinne der Kooperation und Vernetzung noch nicht genutzt wird. Das habe ich zum einen aus der praktischen Perspektive als Therapeutin selbst erlebt, aber auch aus empirischer Sicht gibt es hier noch zu wenige Ansätze und Betrachtungen. Das Zusammenbringen verschiedener Professionen und damit Perspektiven mit dem Ziel der bestmöglichen Prävention und Intervention sollte zukünftig fokussiert in den Blick genommen werden und im besten Falle strukturell verankert werden.
„Wertvolles ‚Potential‘ im Sinne der Kooperation und Vernetzung wird noch nicht genutzt.“
Rebecca Schumacher
Friedo Scharf: Blicken wir auf die Praxis: Wie schätzen Sie die aktuelle Diagnostik von LRS in Deutschland ein?
Rebecca Schumacher: Die Praxis in Bezug auf die Diagnostik im Bereich der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten ist bundesweit heterogen. Es besteht dabei eine Kluft zwischen schulischer und klinischer Betrachtung und daraus folgender Intervention. Die großen Unterschiede zwischen den Bundesländern bzw. Regierungsbezirken führen zu einer großen Unsicherheit auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte. Durch die fehlenden konkreten Empfehlungen, welche sich bspw. auf diagnostische Möglichkeiten beziehen, ist die Entstehungsgeschichte von Diagnosen im Bereich LRS sehr unterschiedlich und nicht fair. Welche Testverfahren in welcher Tiefe für die Diagnose-Stellung eingesetzt werden, ist nicht verbindlich festgeschrieben. Außerdem wird der wachsenden Heterogenität der Schüler:inneschaft, bspw. in Bezug auf Mehrsprachigkeit, nicht entsprechend kompetent und adäquat begegnet.
„Die Entstehungsgeschichte von Diagnosen im Bereich LRS ist sehr unterschiedlich und nicht fair.“
Rebecca Schumacher
Friedo Scharf: Und darauf aufbauend: Welche Rolle spielt das sogenannte „doppelte Diskrepanzkriterium“ noch in der schulischen Praxis – und was halten Sie davon?
Rebecca Schumacher: In der schulischen Praxis wird das Diskrepanzkriterium zunehmend kritisch diskutiert. In der klinischen Diagnostik wird es allerdings – gemäß den (nicht mehr aktuellen) Leitlinien und insbesondere der ICD-11 – nach wie vor angesetzt und die Vergabe einer Diagnose im Bereich LRS und bspw. dem Erhalt eines Nachteilsausgleiches ist daran geknüpft. Empirische Betrachtungen legen jedoch nahe, dass das Kriterium nicht angemessen ist und sich eher an einem einfachen Diskrepanzkriterium nur in Bezug auf die Alters- oder Klassennorm orientieren sollte. Für die individuelle Förder- und Unterstützungsplanung für Schüler:innen mit LRS erachte ich es als sehr wichtig, ein detailliertes Fähigkeitsprofil zu erstellen und eine ganzheitliche Betrachtung der Ressourcen und Barrieren einer Schülerin/eines Schülers vorzunehmen. Hierzu kann auch die IQ-Testung gehören – sie sollte jedoch nicht für die Diagnosestellung zwingend erforderlich sein.
💡Das doppelte Diskrepanzkriterium besagt, dass eine LRS nur dann vorliegt, wenn die Lese- und Rechtschreibleistung signifikant unter dem erwartbaren Niveau aufgrund der Intelligenz und der Alters- oder Klassennorm liegt. Fachlich ist diese Regelung inzwischen stark umstritten.
Friedo Scharf: Warum ist es Ihrer Meinung nach so schwierig, bundesweit einheitliche Standards zu etablieren?
Rebecca Schumacher: Die aktuellen Strukturen im Hinblick auf die Diagnostik im Bereich der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten sind über lange Zeit gewachsene Strukturen, die sicherlich in großen Anteilen dem föderalen Bildungssystem geschuldet sind. Gleichzeitig liegt hier die Schwierigkeit: Auch wenn es bundesländerübergreifende Leitlinien zur Diagnostik und Behandlung von LRS gibt (jedoch wie erwähnt nicht aktuell), so ist doch jedes Bildungsministerium und jeder Schulbezirk selbst Entscheidungsträger über bspw. konkrete Testverfahren, die für die Diagnostik eingesetzt werden. Hinzu kommt, dass die Testlandschaft – insbesondere für den Primarstufenbereich – eine große Anzahl verschiedener Verfahren bereithält und eine Auswahl eines oder mehrerer Verfahren dadurch erschwert wird. Eine Priorisierung in der Auswahl ist dann häufig subjektiv und bspw. auch strukturell-organisatorisch gelöst, also abhängig von verfügbaren Verfahren.
„Ich wünsche mir, dass speziell dafür ausgebildete Fachpersonen diagnostische Prozesse planen, durchführen, auswerten und entsprechende Förderableitungen vornehmen.“
Rebecca Schumacher
Friedo Scharf: Was würden Sie sich konkret für die Diagnostik an Schulen wünschen?
Rebecca Schumacher: Ich wünsche mir, dass speziell dafür ausgebildete Fachpersonen (bspw. Sonderpädagog:innen mit einem Schwerpunkt im Bereich Lernen und Sprache oder akademische Sprachtherapeut:innen) diagnostische Prozesse planen, durchführen, auswerten und entsprechende Förderableitungen vornehmen. Die Grundlage sollte immer ein evidenzbasiertes Vorgehen sein – sowohl in der Planung von Diagnostik als auch in der Planung von Förder- und Unterstützungsmaßnahmen.
„Dysmate lässt sich gut in den Schulalltag integrieren […] und die Ergebnisauswertung erfolgt objektiv.“
Rebecca Schumacher
Friedo Scharf: Kommen wir zu Dysmate: Was unterscheidet dieses Verfahren von anderen?
Rebecca Schumacher: Dysmate ist ein digitales und zweistufiges Testverfahren, welches alle wichtigen Subfähigkeiten im Bereich Lesen und Schreiben und den kognitiven Begleitfähigkeiten systematisch und zeitsparend erfasst. Dadurch lässt es sich gut in den Schulalltag integrieren und zur Ableitung von Förder- und Unterstützungsmaßnahmen nutzen. Durch den Einsatz von Dysmate müssen demnach nicht mehrere unterschiedliche Verfahren eingesetzt werden, Fachpersonen werden durch die automatisierte Auswertung entlastet und die Ergebnisauswertung erfolgt objektiv.
💡Dysmate setzt auf digitale Tests, die standardisiert und normiert sind. In einem Klassenscreening werden alle Schülerinnen und Schüler getestet; auffällige Ergebnisse können im Anschluss gezielt weiter betrachtet und differenziert werden. Das spart Zeit und bietet valide Ergebnisse.
„Der wachsenden Heterogenität der Schülerschaft wird nicht entsprechend kompetent und adäquat begegnet.“
Rebecca Schumacher
Friedo Scharf: Wie wurde Dysmate für Deutschland angepasst?
Rebecca Schumacher: Die Pilotierungs-, Normierungs- und Validierungsstudien zu Dysmate (Y: Klassenstufen 7-10 und C: Klassenstufen 2-6) sind aufwändig geplante und bundesweit umgesetzte Studien. Wir haben verschiedene Regionen Deutschlands einbezogen und sowohl den städtischen als auch den ländlichen Raum bei der Stichprobenziehung berücksichtigt. Die jeweiligen Stichproben sind bewusst so ausgesucht worden, dass sie in Bezug auf die Schulform, den Sprachhintergrund und den Unterstützungsbedarf der Schüler:innen heterogen sind. Damit wollten wir insbesondere der wachsenden Heterogenität in den Klassenzimmern und der sich verändernden Schullandschaft gerecht werden und die bildungsbezogene Inklusion unterstützen.
Friedo Scharf: Abschließend: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten – was müsste sich am dringendsten ändern?
Rebecca Schumacher: Ich wünsche mir, dass die Diagnostik von Lese-Rechtschreib-Leistungen ganzheitlich und durch das Verbinden verschiedener Perspektiven zu einem individuellen und partizipationsorientierten Förderansatz führt.
Friedo Scharf: Herzlichen Dank für das Interview und die Einblicke in Ihre Arbeit.
„Ich wünsche mir, dass die Diagnostik von Lese-Rechtschreib-Leistungen ganzheitlich […] zu einem partizipationsorientierten Förderansatz führt.“
Rebecca Schumacher
Lehrkräfte, die den Dysmate-Test anwenden möchten, absolvieren einen Zertifizierungskurs, der ihnen fundiertes Wissen über LRS, die Testlogik sowie Anleitung zur Auswertung vermittelt. Zusätzlich steht auf www.dysmate.de ein kostenfreier Einführungskurs zur Verfügung. Dort kann auch eine unverbindliche Demonstration angefragt werden.