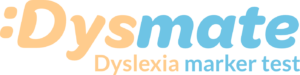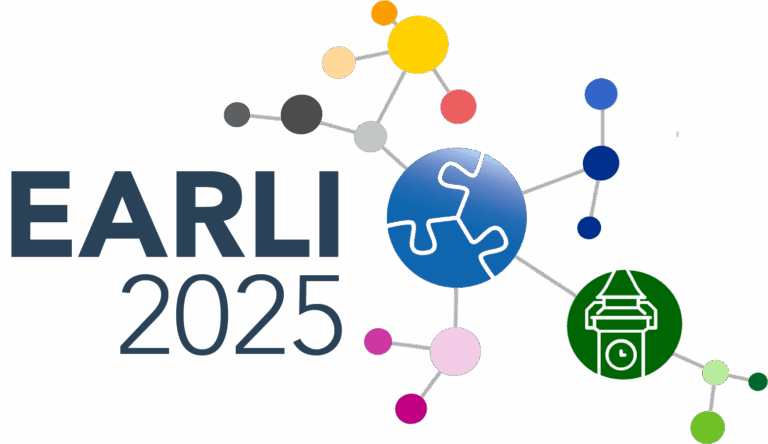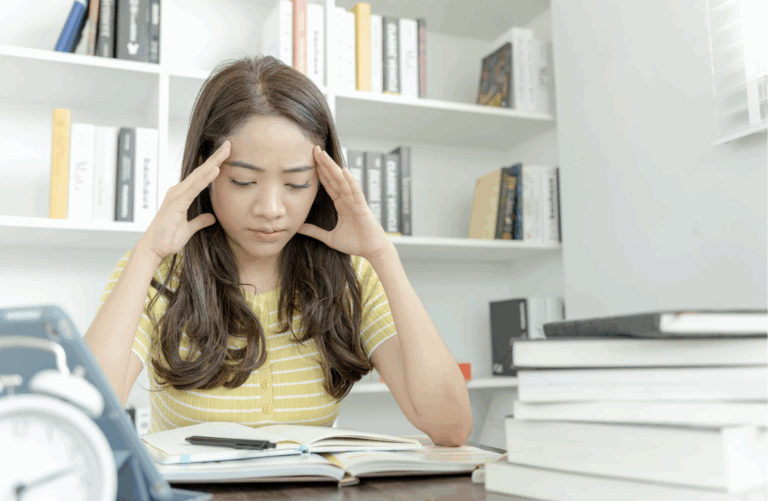Prof. Trude Nergård-Nilssen, 19.08.2025
(Übersetzt aus dem Norwegischen von Dr. Rebecca Schumacher.)
Diese aktuelle Definition wurde im “Journal of Child Psychology and Psychiatry” von Carroll und Kolleg:innen (2025) sowie von Holden und Kolleg:innen im Fachjournal “Dyslexia” veröffentlicht. Beide Publikationen stellen nicht nur die Definition vor, sondern auch deren Bedeutung für die Praxis. Sie geben Empfehlungen, wann, warum und wie Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten festgestellt werden sollten. Die aktuelle Definition ermöglicht ein umfassendes Verständnis dessen, was LRS ist, wie die Auswirkungen im Alltag aussehen können und welche Aspekte im diagnostischen Prozess besonders berücksichtigt werden sollten. Die Definition ist weiter unten übersetzt wiedergegeben.
Warum war eine aktuelle Definition von dyslexia/LRS notwendig?
Der Begriff dyslexia/LRS war lange Zeit umstritten, mit unterschiedlichen Kriterien und Definitionen zwischen Ländern, Fachdisziplinen und auch innerhalb der Praxis. Im englischsprachigen Raum war der Begriff „dyslexia“ vergleichsweise klar gefasst, während im deutschsprachigen Raum unterschiedliche Begriffe wie Dyslexie, Legasthenie, Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit, lese-Rechtschreib-Störung oder Lese-Rechtschreib-Schwäche verwendet werden. Diese Begriffsdiskussion führt in der schulischen Praxis häufig zu Unsicherheiten bei Lehrkräften, Eltern, Fachpersonen und Betroffenen.
Hinzu kommt: In Deutschland entscheidet die Vergabe der Diagnose oft darüber, ob ein Kind Zugang zu Unterstützung, Nachteilsausgleich oder Therapien erhält. Entsprechend groß ist der Bedarf nach einem einheitlichen und empirisch fundierten Verständnis von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten.
Frühere Definitionen, wie das sogenannte IQ-Diskrepanz-Modell oder auch die bekannte Rose-Definition (2009), wurden zunehmend kritisch hinterfragt. Das Diskrepanz-Modell, bei dem eine erhebliche Differenz zwischen der intellektuellen Fähigkeit und der schriftsprachlichen Fähigkeit vorliegen muss, führt dazu, dass viele betroffene Kinder durch das Raster fallen und entsprechend keine Unterstützungsmaßnahmen erhalten. Auch wenn die Rose-Definition von 2009 bereits viele auch heute aktuelle Elemente enthielt, wurde diskutiert, ob die komplexe, dynamische Natur von LRS – inklusive genetischer, kognitiver und umweltbezogener Einflüsse –ausreichend berücksichtigt wurde.
Die aktuelle Definition aus der Delphi-Studie zielt auf ein umfassenderes Verständnis von LRS ab. Sie macht deutlich, dass LRS in Form und Schweregrad über die Lebensspanne hinweg unterschiedlich ausgeprägt sein kann, durch verschiedene kognitive und kontextuelle Faktoren beeinflusst wird und sich nicht in eine einfache Kategorisierung pressen lässt. Dies entspricht auch dem Forschungsstand, der LRS zunehmend als kontinuierliches Phänomen versteht – und nicht als fest abgrenzbare Diagnosekategorie.
Die aktuelle Definition aus der Delphi-Studie von dyslexia/LRS (2025)
Die Expert:innenengruppe einigte sich auf folgende Kernaussagen:
- LRS bezeichnet Schwierigkeiten beim Erwerb von Lese- und Rechtschreibfähigkeiten, die auf zugrunde liegende kognitive Prozesse zurückzuführen sind.
- Bei LRS sind einige oder alle Aspekte der Lesekompetenz im Vergleich zu Alter, Bildungsstand und anderen Fähigkeiten deutlich schwächer ausgeprägt.
- Leseflüssigkeit und Rechtschreibkompetenz gelten als zentrale Marker für LRS – und das alters- sowie sprachunabhängig. (Hinweis: Die Studie betont, dass dies über Altersstufen und Sprachen hinweg als verlässlich gilt.)
- LRS tritt auf einem Kontinuum auf und variiert im Schweregrad. Eine starre Unterscheidung zwischen „Betroffenen“ und „Nicht-Betroffenen“ ist daher wenig zielführend.
- Die Entwicklung und Ausprägung von LRS wird durch eine Kombination genetischer, neurobiologischer und umweltbezogener Faktoren beeinflusst.
- LRS kann sich auch auf andere schulische Bereiche wie Mathematik, das Leseverständnis oder das Erlernen von Fremdsprachen auswirken.
- Eine typische kognitive Schwierigkeit bei LRS betrifft die phonologische Verarbeitung (z. B. phonologische Bewusstheit, Bennenungsgeschwindigkeit oder verbales Arbeitsgedächtnis). Allerdings erklären diese Faktoren nicht alle Unterschiede. (Dies betont die Delphi-Studie ausdrücklich.)
- LRS tritt häufig gemeinsam mit anderen Entwicklungsstörungen auf, z. B. mit sprachlichen Entwicklungsstörungen (SES), ADHS, Dyskalkulie oder motorischen Koordinationsstörungen.
Hinweis zur Begriffswahl: Die Delphi-Studie verwendet in der wissenschaftlichen Diskussion den Begriff “dyslexia”. Im deutschsprachigen Raum wird darunter meist LRS verstanden. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Dyslexia in der Studie als spezifische Form von Lernstörungen betrachtet wird, während LRS im deutschsprachigen Raum oft breiter verwendet wird. Diese feine Unterscheidung ist in fachlicher Debatte relevant, für die schulische Praxis aber häufig weniger bedeutsam.
Fazit
Die Delphi-Studie liefert einen bedeutenden Beitrag zur internationalen Verständigung über die Definition von LRS. Sie bricht mit überholten Diagnosemodellen wie dem IQ-Diskrepanz-Kriterium und rückt stattdessen ein mehrdimensionales, dynamisches und inklusives Verständnis in den Mittelpunkt. Die Definition ist ein Schritt in Richtung einer inklusiveren Diagnostik, die Betroffene nicht durch starre Grenzwerte ausschließt, sondern ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt.
Für die Praxis bedeutet das: Eine frühzeitige und umfassende Diagnostik ist essentiell und Kriterien werden erleichtert. Moderne Screening-Tools wie Dysmate setzen bereits auf solche wissenschaftlich fundierten Marker – wie z. B. phonologische Verarbeitung, Benennungsgeschwindigkeit* und **orthografisches Gedächtnis – und tragen dazu bei, LRS frühzeitig und effizient zu erkennen.
Zukünftig könnte die aktuelle Definition auch helfen, das Verständnis von LRS in unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Kontexten zu vereinheitlichen – und so für mehr Gerechtigkeit im Bildungssystem zu sorgen.
*Die Benennungsgeschwindigkeit (auch Rapid Automatized Naming, RAN) bezeichnet die Fähigkeit, vertraute Reize – wie Farben, Zahlen, Buchstaben oder einfache Objekte – schnell und korrekt zu benennen. Sie gilt in der Forschung als verlässlicher prädiktiver Marker für Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten.
**Das orthografische Gedächtnis bezeichnet die Fähigkeit, sich korrekte Schreibweisen von Wörtern dauerhaft und zuverlässig zu merken. Es ist ein zentraler Bestandteil der Rechtschreibkompetenz und spielt eine entscheidende Rolle beim automatisierten Abruf gespeicherter Wortbilder.
Neue Definition von LRS
Im Frühjahr 2025 wurde eine Delphi-Studie veröffentlicht, die es geschafft hat einen Konsens von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im eglischsprachigen Raum über die Definition von Dyslexia (engl. für Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten) zu erringen. Das Expertengremium bestand aus Fachleuten aus aller Welt, die in mehreren Runden von Diskussionen und Rückmeldungen zu einem gemeinsamen Verständnis gelangten. Ziel war es, eine Definition zu schaffen, die auf neuerer Forschung basiert, über Sprachen und Kulturen hinweg anwendbar ist und klare Leitlinien dafür gibt, wie man LRS erkennen und betroffene Personen unterstützen kann.
Die neue Definition wurde kürzlich von Carroll et al. (2025) im Journal of Child Psychology and Psychiatry sowie von Holden et al. (2025) im Fachjournal Dyslexia veröffentlicht. Die Artikel erklären, wie die Definition in der Praxis genutzt werden kann, und geben Empfehlungen, warum, wann und was untersucht werden sollte, um LRS festzustellen. Sie bietet ein aktuelles und ganzheitlicheres Verständnis dessen, was LRS ist und wie es das Leben eines Menschen beeinflussen kann. Die Definition ist weiter unten übersetzt und wiedergegeben.
Warum war eine neue Definition von LRS notwendig?
LRS war über viele Jahre hinweg ein umstrittener Begriff, mit variierenden Kriterien zwischen Ländern und Fachgruppen. Im englischen Sprachraum gab es da viel mehr Klarheit über die entsprechende Begrifflichkeit. Dyslexia steht eindeutig für das, was im deutschsprachigen Raum unter Dyslexie, Legasthenie und Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten kursiert und in der schulischen Praxis manchmal durcheinander gerät. Manche stellten sogar infrage, ob die Bezeichnung LRS überhaupt verwendet werden sollte. Dies führte zu Unsicherheit bei Lehrkräften, Eltern, Fachpersonen und Betroffenen. Der Bedarf nach einem einheitlicheren und aktuelleren Verständnis ist groß – besonders, da die Diagnose oft entscheidet, wer Zugang zu Unterstützung und Ressourcen erhält.
Frühere Definitionen, wie das IQ-Diskrepanz-Modell oder die Rose-Definition (2009), hatten ihre Grenzen. Die Diskrepanz-Definition, die auf einer Differenz zwischen intellektuellen Fähigkeiten und Leseleistungen basiert, wurde dafür kritisiert, viele Hilfebedürftige auszuschließen und die zugrunde liegenden kognitiven Prozesse zu übersehen. Auch wenn die Rose-Definition der neuen Definition in vielerlei Hinsicht ähnelt, hat sie die dynamische und komplexe Natur von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten – beeinflusst durch genetische wie auch umweltbedingte Faktoren – nicht vollständig berücksichtigt.
Die neue Definition auf Grundlage der Delphi-Studie zielt darauf ab, ein ganzheitlicheres Verständnis von LRS zu vermitteln. Sie erkennt an, dass Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten in Schweregrad und Erscheinungsformen über die Lebensspanne hinweg variieren und durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, einschließlich kognitiver Prozesse und äußerer Bedingungen. Dies bietet eine bessere Grundlage sowohl für die Identifikation als auch für geeignete Fördermaßnahmen.
Die neue Delphi-Definition von LRS (2025)
Die neue Definition, erarbeitet von der Expertengruppe, lautet:
- Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten sind eine Reihe von Verarbeitungsstörungen, die den Erwerb von Lesen und Rechtschreiben beeinflussen.
- Bei LRS sind einige oder alle Aspekte der Lesekompetenz im Vergleich zu Alter, regulärer Beschulung und anderen Fertigkeiten schwach ausgeprägt.
- Schwierigkeiten mit Leseflüssigkeit und Rechtschreibflüssigkeit sind sprach- und altersübergreifend ein zentraler Indikator für LRS.
- Schwierigkeiten im Rahmen von LRS bestehen entlang eines Kontinuums und können im Schweregrad variieren.
- Die Natur und Entwicklung von LRS wird durch eine Kombination genetischer und umweltbedingter Faktoren
- LRS kann auch den Erwerb anderer Fähigkeiten beeinträchtigen, darunter Mathematik, Leseverständnis oder das Erlernen einer Fremdsprache.
- Die typischste kognitive Herausforderung bei LRS sind Schwierigkeiten mit der phonologischen Verarbeitung (z. B. phonologische Bewusstheit, Verarbeitungsgeschwindigkeit oder phonologisches Gedächtnis). Dennoch erklären phonologische Schwierigkeiten nicht die gesamte beobachtete Variation.
- Arbeitsgedächtnis, Verarbeitungsgeschwindigkeit und orthografische Fertigkeiten können beeinflussen, wie sich LRS äußert.
- LRS tritt häufig gemeinsam mit anderen Entwicklungsstörungen auf, wie Entwicklungsbedingten Sprachstörungen (DLD), ADHS, Dyskalkulie oder Koordinationsstörungen.
Empfehlungen zur Diagnostik von LRS
Das Expertengremium gibt klare Empfehlungen für die Diagnostik von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Diese sollte auf mehreren Quellen basieren: Gespräche mit Eltern, Lehrkräften und dem Kind selbst, Beobachtungen sowie standardisierte Tests und altersgerechte Kriterien. Qualitative Beobachtungen und fachliche Einschätzungen sind wichtig, aber standardisierte Tests sichern Objektivität, Konsistenz und Zuverlässigkeit.
Wichtige zu erfassende Bereiche:
- Phonologische Verarbeitung: Bewusstheit, Gedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit.
- Orthografische Verarbeitung: Fähigkeit, Buchstaben- und Rechtschreibmuster zu erkennen und anzuwenden.
- Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit: sollten Teil einer umfassenden Diagnostik sein.
- Flüssigkeit im Lesen und Schreiben: besonders bedeutsam bei älteren Kindern und Erwachsenen.
- Ganzheitliche Betrachtung: Kombination von Tests, Beobachtungen und Gesprächen.
- Entwicklungsperspektive: wie sich LRS über Zeit und Kontexte hinweg entwickelt.
- Komorbiditäten: Abklärung, ob LRS zusammen mit anderen Störungen wie ADHS oder DLD auftritt.
Wie die Dysmate-Tests mit der neuen Definition von LRS übereinstimmen
Warum die Dysmate-Tests zur neuen Definition passen
Die Dysmate-Tests wurden auf Grundlage sowohl der Rose-Definition (2009) als auch der neuen Delphi-Definition (2025) entwickelt. Sie spiegeln das aktualisierte Verständnis von Lese-Rechtschreib-Schweirigkeiten als dynamische, multifaktorielle Beeinträchtigung wider, die Schweregrad und Erscheinungsform verändern kann. Getestet werden phonologische und orthografische Fertigkeiten, Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Damit sind die Dysmate-Tests sowohl an die aktuelle Forschung als auch an die praktischen Anforderungen der Diagnostik und Förderung angepasst.
Wie die Dysmate-Tests LRS erfassen
- Phonologische Verarbeitung: Screening- und Follow-up-Tests messen Bewusstheit, Gedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit durch verschiedene Untertests.
- Orthografische Verarbeitung: Untertests wie Wortdiktat und Schreibgeschwindigkeit erfassen orthografische Bewusstheit und Mustererkennung.
- Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit: Untertests wie Schnelles Benennen, Spoonerism sowie ein spezieller Arbeitsgedächtnis-Test.
- Flüssigkeit: Wortdiktat, Schreibgeschwindigkeit und Eineminute-Test prüfen Schreib- und Dekodierflüssigkeit.
- Komorbiditäten: Die Tests beinhalten sprachlich-kognitive Marker für DLD, sodass man LRS von DLD-bedingten Schwierigkeiten unterscheiden kann.
Damit bieten die Dysmate-Tests ein solides Fundament für Diagnostik und Förderung bei LRS.
Wie die Dysmate-Tests auch Sprachentwicklungsstörungen erfassen
Die Dysmate-Tests sind nicht nur auf LRS ausgerichtet, sondern können auch sprachlich-kognitive Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Sprachentwicklungsstörungen identifizieren. Schon jetzt können sie Komorbiditäten von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten und Sprachentwicklungsstörungen erfassen.
Ab Herbst 2025 werden die Versionen Dysmate C, Y und A überarbeitet und um drei neue Untertests ergänzt, die eine klare Differenzierung zwischen LRS und Sprachentwicklungsstörungen ermöglichen:
- Sprachverständnis: besonders relevant für das Erkennen von Sprachentwicklungsstörungen.
- Kognitive Marker für Sprachentwicklungsstörungen: die beiden bekanntesten Marker werden integriert.
Diese Erweiterungen stärken die Fähigkeit der Tests, präzisere Diagnosen und passgenaue Fördermaßnahmen für verschiedene Formen von Lese- und Sprachschwierigkeiten zu ermöglichen.