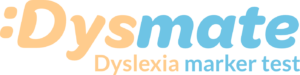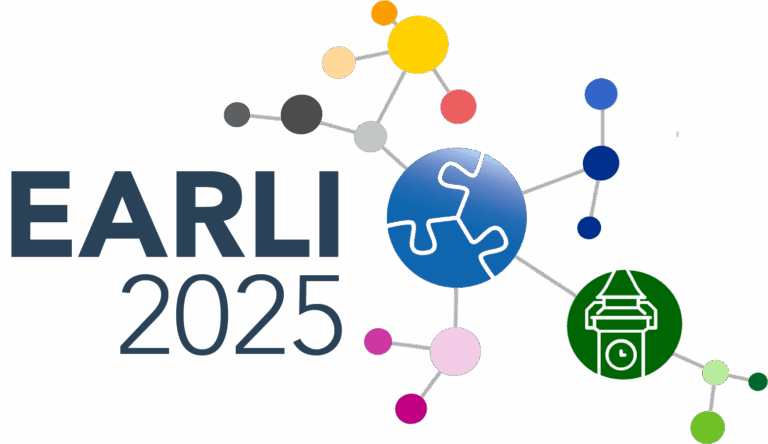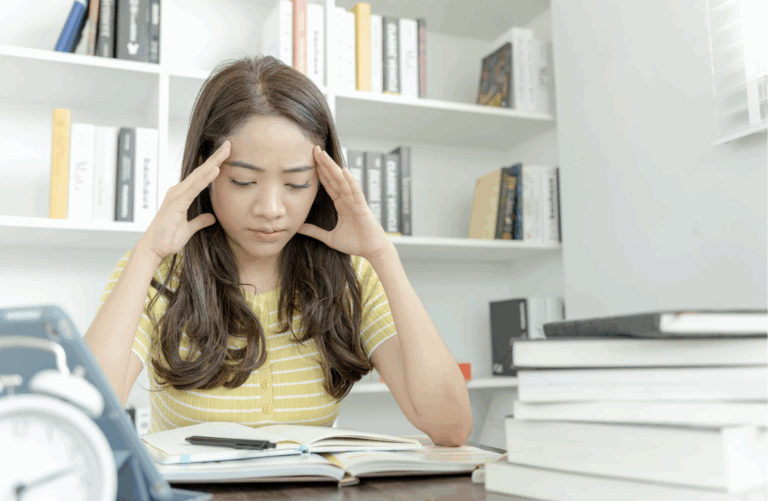Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) sind eine der häufigsten Ursachen für schulisches Scheitern – und dennoch dauert es in Deutschland oft viele Monate oder sogar Jahre, bis betroffene Kinder eine fundierte Diagnose und angemessene Unterstützung erhalten. Dabei wäre eine frühzeitige, umfassende und zugleich praktikable Diagnostik der Schlüssel für wirksame Förderung.
Friedo Scharf, Sonderpädagoge und Gründer der digitalen Förderplanungs-App SPLINT, kennt diese Problematik aus eigener Erfahrung – beruflich wie persönlich. Die Geschichte seines Sohnes, bei dem die Diagnostik über ein Jahr dauerte, wurde für ihn zum Anstoß, etwas zu verändern. Seine Suche nach einer besseren Lösung führte ihn zum norwegischen Testverfahren Dysmate, das inzwischen auch im deutschsprachigen Raum eingesetzt und wissenschaftlich begleitet wird.
Im Gespräch mit Olga aus dem norwegischen Dysmate-Team, die maßgeblich am Erfolg von Dysmate in Norwegen beteiligt ist, geht es um die Entstehung dieser Kooperation, die Stärken der digitalen Testbatterie – und um die Vision, wie Diagnostik und Förderung in Zukunft zusammenspielen sollten.
Olga: Friedo, schön, dass wir endlich Zeit finden, über Dysmate zu sprechen. Du hast das Verfahren ja nach Deutschland geholt – was hat dich dazu bewegt?
Friedo: Für mich war das eine sehr persönliche Entscheidung. Mein Sohn hat selbst eine ausgeprägte Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit. Die schulische Förderung lief zunächst gut, aber sobald klar war, dass eine offizielle Diagnostik ansteht, wurde alle Förderung ausgesetzt – für ein ganzes Jahr. Ich bin selbst Sonderpädagoge und habe ihn privat unterstützen können, aber ich habe mich gefragt: Was passiert mit Kindern, deren Eltern nicht diesen Hintergrund haben?
Olga: Das zeigt, wie dringend wir Diagnostik brauchen, die nicht blockiert, sondern Förderung ermöglicht. In Norwegen war das einer der wichtigsten Gründe für die Entwicklung von Dysmate. Die Idee war von Anfang an, ein Verfahren zu schaffen, das schnell und niedrigschwellig anwendbar ist – und trotzdem wissenschaftlich valide.
Friedo: Genau das hat mich überzeugt. Als ich Dysmate kennengelernt habe, war für mich klar: Das ist nicht einfach ein weiterer Test, sondern ein System, das die Praxis wirklich entlasten kann. Wir können innerhalb einer Schulstunde eine ganze Klasse testen, digital und standardisiert. Und das ohne dass Lehrkräfte die Verantwortung für die Auswertung tragen müssen.

Olga: Die automatische Auswertung ist aus meiner Sicht ein Schlüsselfaktor. Sie spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für Objektivität. Alle Kinder erhalten die gleichen Bedingungen, und die Ergebnisse stehen sofort zur Verfügung.
💡 Bisher gibt es in Deutschland kein Testverfahren, das alle relevanten Bereiche von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten umfassend erfasst und gleichzeitig im Schulalltag flächendeckend einsetzbar ist.
Olga: Du hast vor einigen Jahren ja auch die Förderplanungs-App SPLINT entwickelt. Welche Rolle hat SPLINT bei deiner Entscheidung gespielt, Dysmate nach Deutschland zu holen?
Friedo: SPLINT war tatsächlich der konkrete Auslöser. Ich habe die App als digitale Lösung für individuelle sonderpädagogische Förderplanung entwickelt und war auf der Suche nach einer Diagnostik, die sich perspektivisch gut daran anschließen ließe. Dysmate hat perfekt gepasst. Anfangs habe ich nur den Kontakt zwischen dem norwegischen Dysmate-Team und deutschen Universitäten hergestellt. Als dann klar wurde, wie aufwändig eine Normierungsstudie ist, wenn man viele Schulen, verschiedene Dialekte und regionale Unterschiede berücksichtigen will, haben wir SPLINT genutzt, um die Erhebung digital zu organisieren. Weil SPLINT schon in vielen Schulen eingesetzt wird und die technischen Voraussetzungen mitbringt, konnten wir so eine viel größere Vergleichsgruppe einbeziehen, als sonst möglich gewesen wäre. Diese Zusammenarbeit hat sich dann immer weiter intensiviert.
Olga: Und wie sieht die Perspektive aus? Ist geplant, Dysmate direkt an SPLINT anzubinden?
Friedo: Ja, das ist tatsächlich unser Ziel. Die Idee ist, dass die Ergebnisse aus der Dysmate-Testung direkt in SPLINT übertragen werden können. Auf dieser Basis sollen dann automatisch differenzierte Fördervorschläge entstehen, die die Lehrkräfte direkt nutzen können. Auch individuell passende Nachteilsausgleiche könnten so vorgeschlagen werden – orientiert an den spezifischen Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Das würde die Dokumentation vereinfachen und dafür sorgen, dass die Qualität der Unterstützung nicht davon abhängt, ob eine Lehrkraft sich in dem Thema besonders gut auskennt oder nicht. So wäre eine gute Förderung unabhängiger vom Schulstandort und könnte viel verlässlicher gelingen.
Olga: Das klingt nach einer wirklich synergetischen Entwicklung. Und das Ziel war ja von Anfang an, Diagnostik und Förderung enger miteinander zu verzahnen. Ich denke, SPLINT und Dysmate ergänzen sich da hervorragend.
Friedo: Ja, absolut. Und ich glaube, genau solche Verbindungen zwischen wissenschaftlich fundierter Diagnostik und praxistauglicher Umsetzung brauchen wir, wenn wir Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten in der Breite frühzeitig erkennen und sinnvoll begegnen wollen.
Friedo: Und das ist dringend notwendig. In Deutschland erleben wir oft, dass die Diagnose von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten entweder sehr aufwändig ist oder sich auf zu enge Verfahren stützt. Viele Schulen nutzen beispielsweise ausschließlich die Hamburger Schreibprobe – die aber gar nicht als vollständige LRS-Diagnostik gedacht ist.
Olga: Genau, und was dabei oft zu kurz kommt, ist das Lesen. Dabei wissen wir aus der Forschung, dass gerade die Kombination aus Lesetempo, Leseverständnis, phonologischer Bewusstheit, Benennungsgeschwindigkeit und orthografischem Gedächtnis entscheidend ist, um die Schwierigkeiten wirklich zu verstehen.
💡 Eine fundierte Diagnostik sollte alle Teilbereiche von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten einbeziehen: Lesen, Schreiben, phonologische Bewusstheit, orthografisches Gedächtnis, Benennungsgeschwindigkeit und mehr.
Friedo: Und genau das bietet Dysmate. Es ist eben keine punktuelle Erhebung, sondern eine differenzierte Testbatterie, die die verschiedenen Prozesse erfasst, die beim Lesen- und Schreibenlernen eine Rolle spielen. So können wir nicht nur sagen: Hier gibt es ein Problem – sondern auch: wo genau liegt es, und was braucht dieses Kind jetzt?
Olga: Und diese Ausdifferenzierung macht einen Unterschied. Auch in Norwegen war ein Ziel, Schulen nicht nur ein Testergebnis zu liefern, sondern eine fundierte Grundlage für die weitere Förderplanung. Lehrkräfte sollen nicht raten müssen, was zu tun ist.
Friedo: Das ist besonders wichtig in Bezug auf den Nachteilsausgleich. In Deutschland passiert es häufig, dass pauschale Maßnahmen wie Zeitverlängerung gewährt werden, ohne dass klar ist, ob das eigentlich hilft. Der Nachteilsausgleich soll sich aber individuell am konkreten Bedarf orientieren – und dafür brauchen Schulen differenzierte Informationen.
Olga: Und auch valide Informationen. Als wir uns kennengelernt haben, hast du erzählt, dass es in Deutschland immer noch die Situationen gibt, in denen das sogenannte Diskrepanzkriterium verlangt wird, um etwa eine Lerntherapie über das Jugendamt bewilligt zu bekommen.
Friedo: Leider ja. Schulisch ist es ausgesetzt, aber wenn Eltern eine Lerntherapie über das Jugendamt beantragen möchten, ist es meist noch relevant, obwohl es fachlich längst überholt ist. Spätestens die kürzlich durchgeführte internationale Delphi-Studie zum Thema LRS (engl. Dyslexia) von Carrol, Holden, Kirby, Thompson, Snowling macht klar: Das Diskrepanzkriterium sollte keine Rolle mehr spielen.
💡 Das Diskrepanzkriterium verlangt einen großen Abstand zwischen Intelligenz und Lese-/Rechtschreibleistung, um eine LRS-Diagnose zu stellen. Laut Delphi-Studie ist es jedoch kein zulässiges Kriterium mehr.
Olga: Und Dysmate orientiert sich genau an diesen internationalen Standards. Es ist so konzipiert, dass es eine valide Diagnose ermöglicht – ohne auf das Diskrepanzkriterium zurückgreifen zu müssen.
Friedo: Das ist ein großer Fortschritt. Ich hoffe, dass das dazu beiträgt, dass sich auch die Praxis in Deutschland über kurz oder lang an diesen wissenschaftlichen Konsens annähert. Wir haben jetzt ein Instrument, das das ermöglicht.
Olga: Friedo, vielen Dank fü das Gespräch und für deinen Einsatz für mehr Chancengerechtigkeit!
Friedo: Danke dir, Olga. Ich freue mich, dass wir gemeinsam daran arbeiten.